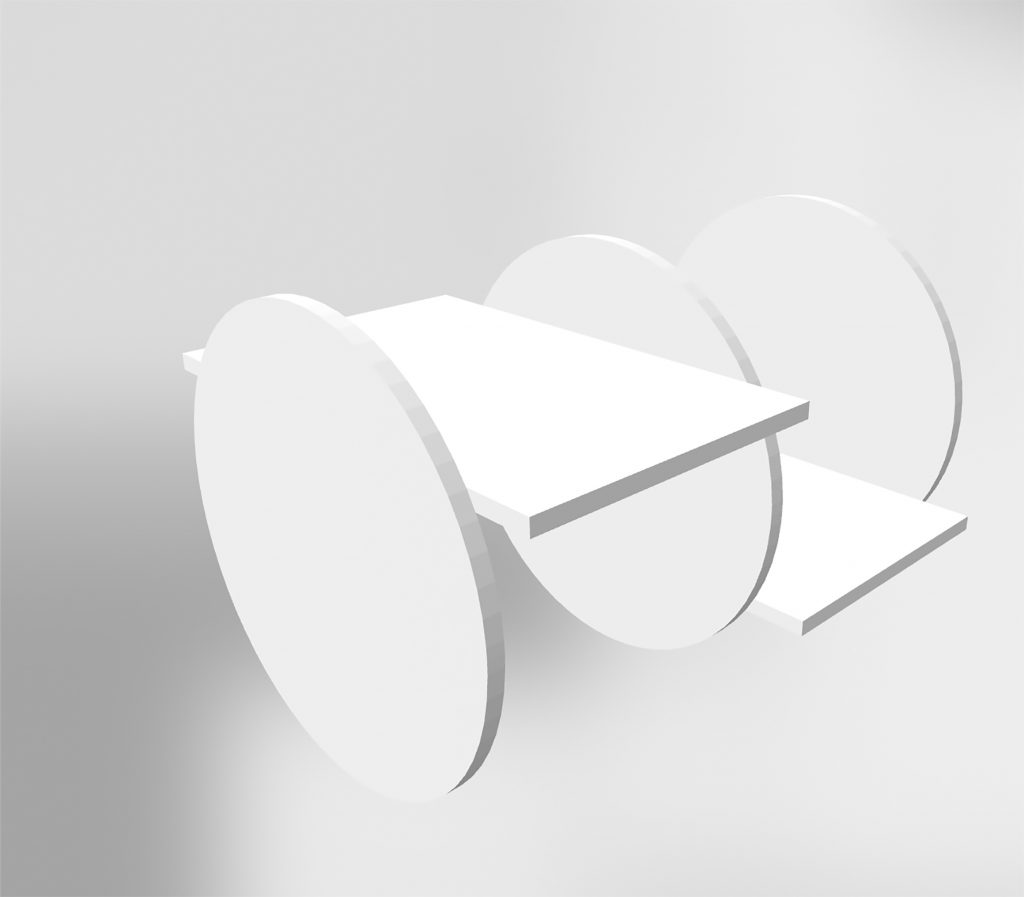
Janina Audick, Professorin Bühnenraum und Studiengangsleitung Bühnenbild an der Fakultät Darstellende Kunst:
„Räumliche Entwürfe lassen sich digital nicht erfassen. Die Grenze ist im Grunde genau die Differenz zwischen realem Raum und dem medialem Interface, dass der sogenannte „digitale Raum“ ja ist. Als ein Werkzeug unter vielen lässt sich der digitale Raum untersuchen. Aber wie gerade praktiziert verstärken sich durch die Digitalisierung die Effekte der Isolation und Einsamkeit.
Eine Aufführung zum Beispiel lebt von der Kopräsenz und wenn man diese ins Digitale übersetzt, dann ändert sich etwas Grundsätzliches in der Wahrnehmung, in der Räumlichkeit und Leiblichkeit. Die Aufführung wird auf ein bewegtes Bild reduziert und die Bühne auf den Bildschirm.“
Susanne Lorenz, Professorin der Grundlehre am Institut für Kunst:
„In meiner künstlerischen Arbeit fühle ich mich derzeit kaum eingeschränkt, abgesehen von dem Umstand, dass wichtige Treffen mit Firmen und Personen nicht ganz so lebendig sein können und Materialbeschaffung zum Teil mühselig und in jedem Fall abstrakter ist. Meine nächsten Projekte sind teils absichtlich, teils zufällig der Lage angepasst. So wird es im April eine Ausstellung in Berlin von mir und einem Künstler geben, die ausschließlich von Außen betrachtet werden kann und daher von vornherein im Hinblick auf die derzeitigen Bedingungen konzipiert ist. Parallel wird es an einem anderen Ort, im Hof eines Ausstellungshauses eine Skulptur geben, die aufgrund ihrer Lage und langen Ausstellungszeit glücklicherweise in Präsenz zu sehen sein wird. Anschließend geht es um ein Projekt in der Schweiz, das ebenfalls im Außenraum realisiert wird. Meine Arbeitsweise mit dem Schwerpunkt auf Objekten und Installationen im Außenraum kommt mir also in Bezug auf die derzeit eingeschränkte Sichtbar- und Erlebbarkeit zugute.“
Lucas Blondeel, Professor für Klavier am Institut für künstlerische Ausbildung:
Musik lebt vom Zusammenkommen und vom Moment, das sind Sachen, die bei Aufzeichnungen ihre Prägnanz verlieren. Aber es gibt durchaus tolle Formate. Ich habe dadurch, dass alle Konzerte ausgefallen sind, angefangen, Home Videos zu drehen, bei denen man auch mehr erklären konnte. Man findet Wege, mit dem Publikum zu kommunizieren, doch ich vermisse schon sehr die Konzerte.
Ina Bierstedt, Gastdozentin für Malerei und Zeichnen am Institut für Kunst:
Malerei, die sich mit digitaler Ästhetik befasst, gibt es natürlich heute überall zu sehen. Das Bildrepertoire aus Games oder Videoclips kann ein visuelles Thema sein, um eine malerische Haltung zu entwickeln. Da gibt es viele Schnittstellen und deutliche Bezüge.
Die Malerei aber punktet durch ihre Stofflichkeit, Farbe, Gerüche, chemische Reaktionen und Haptik und durch die reale Präsenz des Bildes im Raum. Das ist das Wunderbare und Besondere an der Malerei. An dieser Stelle versagt in der Regel der Transfer ins Digitale.
Momentan, wo reale Besuche in Ausstellungsräumen nicht möglich sind, können Online- Führungen wenigstens eine Vorstellung von der Größe der Bilder oder Hängung im Raum vermitteln, aber das Wesentliche am Bild, die eigene Zeitspanne der Betrachtung, der Blickwinkel, die eigene Bewegung zum Bild hin und zurück, diese Vergegenwärtigung fehlt.
Jessica Haß, Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Fakultät für Gestaltung:
Ich glaube, das Schwierigste ist für die meisten vor allem, das Zeitliche und Organisatorische unter einen Hut zu bekommen – gerade für Menschen, die Kinder haben. Aber die wissenschaftliche Arbeit an sich lässt sich zumindest in meinem Falle gut durchführen. Das kommt natürlich stark auf die Forschung an. In der GWK geht es viel um Gegenwartsbeobachtung, da ist gerade die derzeitige Situation höchst interessant. Ich selbst interessiere mich für das Thema Grenzen und Entgrenzung. Wir leben in scheinbar entgrenzten, fluiden Zeiten. Doch dann kommt ein Virus und schafft mit einem Mal lauter neue Grenzen und Begrenzungen. Einerseits auf politischer Ebene, was für alle, die mit dem Schengenabkommen aufgewachsen sind, ein großer Schreck war, aber auch Grenzen zwischen Menschen durch Kontaktbeschränungen usw. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch eine stärkere Entgrenzung durch das Virtuelle. Wenn man überlegt, dass Arbeit und Privates sich in Zeiten von Home Office noch stärker als zuvor vermischen, sowohl zeitlich als auch räumlich, wird diese Entgrenzung, die viel ausgeprägter als zuvor war, klar. Wir haben nie so viele Einblicke in das Leben unserer Kolleg*innen und Studierenden bekommen – das ist schon einzigartig und das hatten wir so zuvor noch nicht. Insofern für Forschung sehr spannend.





