
Zukunft Kollektiv appelliert an gesellschaftliches Engagement, fördert kulturelle Vielfalt und hat Inklusion und Gleichstellung zum Ziel. Die künstlerischen Arbeiten geben einen Anstoß zum Umdenken und regen einen Perspektivwechsel an, indem sie dazu einladen, einen neuen Standpunkt einzunehmen. Ausgangspunkt ist die Region „NAWA”, welche die Regionen Nordafrika und Westasien bezeichnet. Wir haben den Namen Zukunftskollektiv ausgewählt, weil wir alle durch unsere Entscheidungen, unser Verhalten und unsere Verantwortung bestimmen, wer und wie wir in Zukunft sein werden.
In ihren Arbeiten setzen sich sechs Künstler*innen mit der Frage auseinander, ob sich die Identität in einem Zustand des Wandels oder der Stabilität befindet. Ihre Kunstwerke machen aufmerksam auf die Probleme von Minderheiten, die aufgrund von Geschlecht, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit Benachteiligungen erfahren. Unter dem Motto „Vielfalt und Dialog versus Marginalisierung“ möchte die Ausstellung eine Diskussion um Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs jenseits von Assimilierung oder Ausgrenzung anregen.
Die künstlerischen Beiträge sind hier online zu sehen.

Die beteiligten Positionen sind breit gefächert: Tewa Barnosa interessiert sich für Sprache und ihre Elemente sowie die Rolle der Literatur im Kampf gegen die Tyrannei. Dr. Haneef Shareef schreibt Gedichte und Kurzgeschichten. Hierin zeigt sich sein Engagement für das Leben in seinem Herkunftsland, den Bergen von Belutschistan. Sarai Meyron setzt sich in ihrem Podcast “Art Life” mit existentiellen Themen wie Herkunft sowie Rollen- und Geschlechterzuweisung auseinander. Ilayda Çakir präsentiert ein Video zum Thema kulturelle Identität zwischen Orientalismus und Patriarchat und der Rolle der Frau. In seinem Text “Kulturelle Hybridität in der Musik der Syrischen Kirchen” nähert sich Dr. Maher Farkouh von wissenschaftlicher Seite dem zentralen Thema, der hybriden Identität und ihrer Rolle. In einer Video-Performance thematisiert Bahzad Sulaiman die Bedeutung von Farben und ihre Funktion als Ausdruck von Widerstand.
Kuratorische Konzepte, politische Ziele

Dieses Projekt richtet sich gegen alle patriarchalen Elemente und Überbleibsel kolonialen und faschistischen Denkens. Was wir bis jetzt erreichen konnten, ist eine freie und unabhängige Plattform zu schaffen, die die Erfahrungen in der gesamten Region NAWA vereint. Ich habe mit den Künstler*innen von Anfang an ein Protokoll etabliert. Einer der Hauptpunkte war, dass Gewalt, Extremismus, Fanatismus, Faschismus, Antisemitismus, antimuslimischen und antiarabischen Hassreden kein Raum gegeben würde.
Leider führen in einigen Fällen politische Gruppen in der NAWA-Region im Namen ethnischer, religiöser, kultureller und nationaler Minderheiten einen rassistischen und populistischen Diskurs gegen Araber*innen und Muslim*innen. Als Künstler und Kurator ist es mir wichtig, mit Rassismus in all seinen Formen umgehen zu können und ihn strukturell zu bekämpfen. Das Verstehen der Eigenheiten und der Sensibilität in Bezug auf Identitätsfragen ist etwas, das alle an der Mediation Beteiligten verstehen müssen. Wir wollten mit dem Projekt “Zukunft Kollektiv” einen safe space schaffen, in dem Künstler*innen ihre Ansichten frei und unabhängig äußern können durch Methodik, Kunst, Forschung und Aktivismus.
Die Entstehung von Nationalstaaten in verschiedenen Regionen der Welt während der Epochen des Kolonialismus, der Moderne sowie der Globalisierung hatte die Bildung von hybriden Identitäten und eine Zusammenführung von diversen Sprachen, Dialekten und Kulturen zur Folge. Dabei werden diese vielfältigen Sprachen, Rituale und künstlerischen Positionen verdrängt und unterliegen dem Zwang, sich in den Schmelztiegel der hybriden Identität zu integrieren. Der Grundsatz der Inklusion wird dabei außer Acht gelassen. Diese Marginalisierung reicht von kultureller Ausgrenzung bis zur Unterdrückung, die mit Gewaltanwendung, Inhaftierung und Völkermord einhergeht.
Das Hauptziel des Projekts ist die Schaffung einer Kommunikationsplattform für die Teilnehmer*innen, um das koloniale Denken der nationalen Zentralisierung abzubauen. Die Geschichte der nordafrikanischen und westasiatischen Region im Bezug auf hegemoniale Ideen wie arabisch-nationalistisches Denken, das islamische Kalifat, Nationalpopulismus, Autoritarismus, Antisemitismus und patriarchale Strukturen sollen in Frage gestellt werden. Wir wollen versuchen, sie zu zerlegen und diese Ideologien zu bekämpfen. Es soll ein kulturelles Umfeld entstehen, das für die aktuelle Gesellschaft geeignet ist und eine Chance für eine gemeinsame Zukunft bietet. Außerdem soll eine kritische Dekonstruktion hybrider Identität stattfinden, sowie die ursprüngliche Kultur und Sprache nach Jahren der Marginalisierung neu verhandelt werden.

Dieses Projekt war wie ein Manifest, das die Tür zu lange Zeit verdrängten Fragen öffnete. Der Name “NAWA” fungierte als Anreiz für den Beginn eines Wandels in kulturellen Institutionen, Vereinen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ich hoffe, dass wir einen neuen künstlerischen und kulturellen Dialog in der Ära des Postkolonialismus und des Posttotalitarismus in meinem Herkunftsland Syrien gestalten können, wie es Andere beispielsweise gerade im Irak und in Libyen versuchen. Die Demontage des zunächst durch die koloniale Rolle und später durch zentralnationalistisch-totalitäre Regime gefestigten kulturellen Bildes der Zentralbürger*innen in der NAWA-Region ist heute von großer Bedeutung in der Kulturarbeit. Dieses Bild stellt oft einen Mann dar: einen konservativen, patriotischen, religiösen, arabisch sprechenden Muslim. Dieses Bild muss neu definiert und hinterfragt werden, um Raum für andere Identitäten zu schaffen.
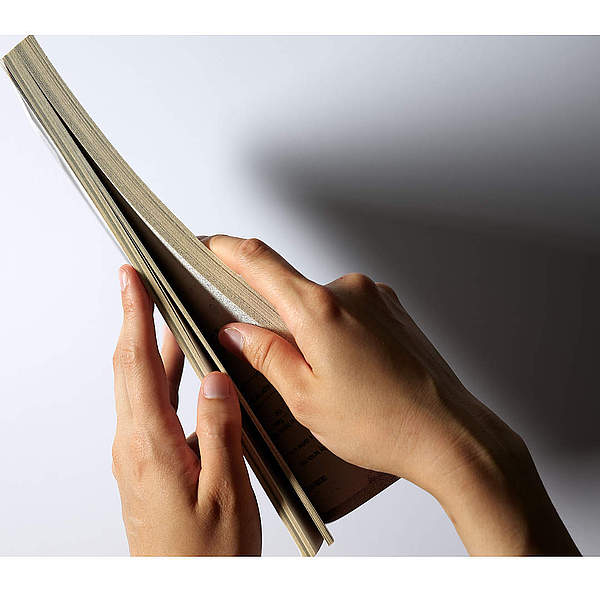
Ich glaube, dass die Zukunft in kollektiver Verantwortung liegt. Heute erleben wir in Nordafrika und Westasien eine neue Bewegung, die kulturelle Identitäten aufdeckt, die zuvor unterdrückt wurden. Die Idee des Projektes war es, einen Ausgangspunkt zu schaffen für eine zukünftige künstlerische und kritische Vision der Region. Ich habe viel von den teilnehmenden Künstler*innen gelernt und gemeinsam haben wir ein Projekt entwickelt, das uns verschiedene Formen und Ideen zu kulturellen Identitäten sowie eine neue Vision für die Rolle des Individuums und der Individualität in der Gesellschaft ermöglicht hat. Ich möchte allen Teilnehmer*innen für die ausdrucksstarken Kunstwerke danken, die die Ausstellung jedes Mal in eine neue Richtung gelenkt und bereichert haben.

Informationen zur Ausstellung an der UdK in der Woche vom 30.09. – 07.10.2022 von 15:00 bis 19:00 Uhr.
Der Künstler und Kurator Ammar Hatem lebt seit zwei Jahren in Berlin. Derzeit macht er seinen Master an der Universität der Künste Berlin im Fachbereich Kunst im Kontext. Er kam 2015 nach Deutschland, wo er in Göttingen an vielen Projekten und Workshops beteiligt war. Er wurde in Damaskus in eine drusische Familie hineingeboren. Dort studierte er an der Universität der Schönen Künste von Damaskus. Sein Schwerpunkt ist der häufig von Institutionen geleitete Diskurs zum Thema der kulturellen Identität.
Dieses Projekt wurde durch das Museum Friedland, Migrationszentrum für Stadt und Landkreis des Diakonieverbandes Göttingen und der Gesellschaft für bedrohte Völker e. V. ermöglicht.





