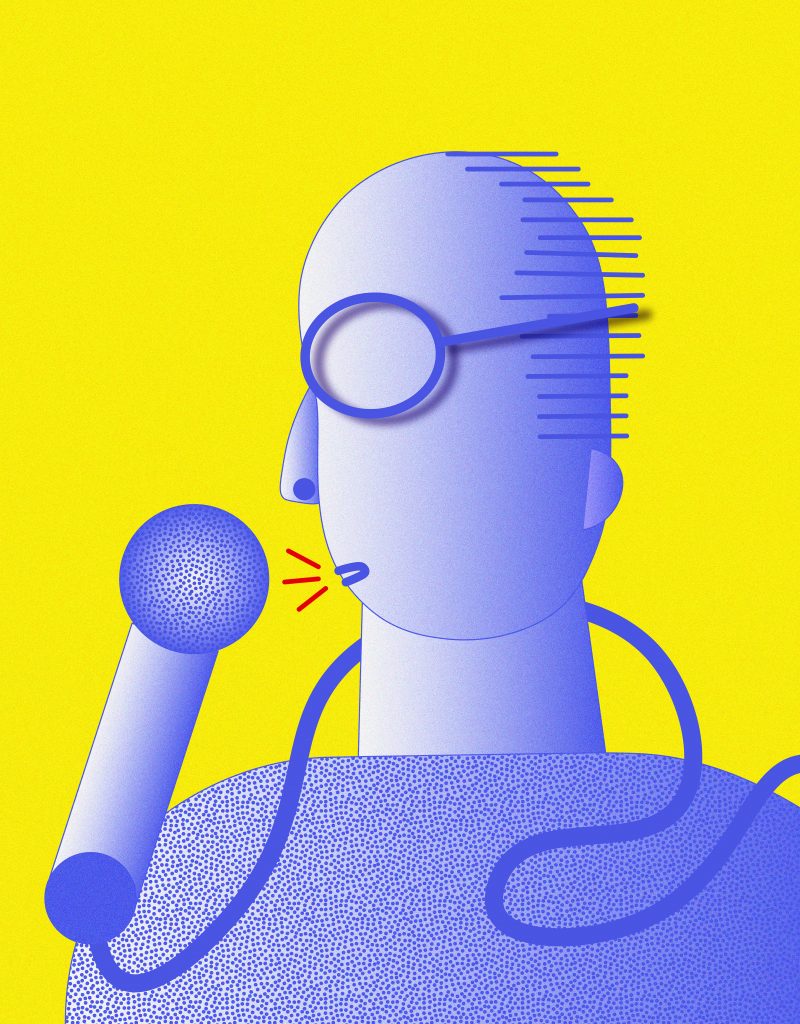
@timstrrrrrrr
Seit April 2020 sind Sie unser Uni-Präsident. Welche Bilanz ziehen Sie nach diesem außergewöhnlichen Jahr?
Sie haben Recht, es war ein besonderes Jahr. Zwei Wochen bevor ich meine offizielle Ernennung erhalten habe, begann der Lockdown – seitdem bemühe ich mich um das Aufrechterhalten einer gewissen künstlerischen Praxis. Neben der “Ambulanten Versorgung” der Hochschule stand die Suche nach Möglichkeiten der künstlerisch-inhaltlichen Nutzbarmachung dieser Zwangssituation im Fokus.
Beispielsweise hat die Digitalisierung der UdK bisher kaum eine Bedeutung gehabt. Meine Haltung ist hier eine etwas andere: ich sehe sie nicht als eine möglichst praxisnahe Emulation eines analogen Erlebnisses, sondern als neues Territorium künstlerischer Aktivitäten. Diese Aktivitäten haben auch eine politische Ebene, da sich über das Digitale neue, spannende Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen…
… aber auch Hürden aufbauen.
Natürlich sehe ich die Gefahren im Digitalen, die Probleme der digitalen Praxis und die Schwierigkeiten in der Zugänglichkeit. Gleichzeitig ist auch eine neue Art des Kontakts entstanden, die Berührungsängste abbaut und neue inner- und außeruniversitäre Kommunikationswege schafft. Digitale Medien können beim Abbau institutioneller Schwellen hilfreich sein.
Ein zentrales Thema war die Frage einer anderen Diversität und wie wir Diskriminierungstatbestände in unserem (Universitäts-)Alltag bekämpfen können. Deshalb wurde ein Runder Tisch initiiert, bei dem sich die Vizepräsidentin ein Mal im Monat mit Akteur*innen zum Gespräch trifft. Uns ist sehr wichtig, dass sich die Hochschule wirklich öffnet, andere Stimmen hört und kritisch reflektiert. In einem ersten Schritt haben wir auf Studierendeninitiative versucht, die ökonomische Zugänglichkeit zu den Deutschkursen zu verbessern.
Ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist eine Stärkung der Kommunikation zwischen den Fakultäten. Ein erster Schritt war die Projektarbeit zum Open Call im Sommer. Zudem möchten wir das Studium Generale in Bezug auf eine Anrechenbarkeit und die Betreuungssituation verbessern. Zusätzlich soll das Steinhaus im Zentrum des Gartens der Hardenbergstraße unter Führung des AStA zu einem Ort der überfakultären Begegnung werden. Im Sommersemester ist ein Wettbewerb zur Gestaltung und Nutzung unter Beteiligung aller Fakultäten geplant.
Ein besonderes Augenmerk lag auch auf der Lehramtsausbildung an der Fakultät 1. Wir setzen auf eine neue Gesprächskultur, die es ermöglicht, sich den Problemen zu widmen.
So diskutieren wir neue Ideen zum Studienverlauf und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, die vielleicht auch neue Studiengänge hervorbringen werden. Auch mit der Raumfrage beschäftigen wir uns intensiv. Mein Kollege Prof. Jean-Philippe Vassal hat einen Vorschlag für die Überdachung des Zwischenhofes zwischen Quergebäude und Bildhaueratelier gemacht. Mit seinen Entwürfen werden wir weiter versuchen, die Werkstattsituation zu entspannen.
Atelierarbeit, Übe- und Lehrbetrieb sind immer noch reglementiert und werden es voraussichtlich auch im kommenden Semester noch bleiben. Unabhängig davon leidet die UdK unter einem massiven Raummangel. Welche Aussichten auf Entspannung bestehen?
Bereits im vergangenen Juli habe ich intern sehr deutlich gemacht: Wir brauchen eine nachhaltige Raumnutzung und müssen uns als “sharing-community” verstehen.
Es gibt jedoch Ängste, die auch aus der institutionellen Geschichte herrühren, dass die Fakultäten den Zugriff auf ihre proprietären “Besitztümer” verlieren könnten. Deshalb glaube ich, dass wir gemeinsamen mit den Dekanaten eine Kultur des gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Verbindlichkeiten etablieren müssen.
Wäre die flächendeckende Einführung eines Raumbuchungssystems eine Lösung?
Zuerst müssen die Fakultäten ihre Kernnutzung definieren, es muss klar sein, wann welche Räume zum Unterricht genutzt werden – dann gibt es sicherlich einen Bereich, der für alle Fakultäten nutzbar gemacht werden kann. In Fakultät 3 findet das ASIMUT-System [Anm. d. Red: Online-System zur Raumbuchung für Teile der Fakultät Musik] ja bereits Anwendung. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir in Zeiten wie diesen keine zusätzlichen Flächen anmieten können, wenn wir eigentlich Räume haben, die zeitweise ungenutzt sind. Vielmehr müssen wir einen Nachhaltigkeitsdiskurs führen.
Viele Studierende beklagen sich über einen schwierigen Informationszugang bezüglich des Pandemiebetriebs. Die Internetseite ist mittlerweile sehr unübersichtlich geworden, häufig wird nur die Presseerklärung der Senatskanzlei veröffentlicht, selten erhält man eine erklärende Mail und selbst auf Twitter wird nicht mehr über die Corona-Situation informiert. Gerade für Menschen, deren erste Sprache nicht Deutsch ist, ist eine klare und verständliche Kommunikation durch die Universität von Bedeutung.
Das Problem war mir nicht bekannt. In den Leitungsrunden versuchen wir uns neben den Stimmen aus den Fakultäten auch Feedback vom AStA zu holen. Vor wenigen Wochen wurden zudem die Corona-Kacheln auf der Website neu sortiert und vereinheitlicht. Ich werde aber darauf hinwirken, dass in den Social Media-Kanälen die aktuellen Entwicklungen besser abgebildet werden. Zu Beginn der Pandemie habe ich zusammen mit der Kanzlerin mehrfach einen Brief zur aktuellen Lage geschrieben, da es mir ein Bedürfnis war, direkt mit den Angehörigen der UdK zu kommunizieren. An dieser Praxis sollten wir festhalten.
Können Sie etwas zu den Corona-Zahlen an der UdK sagen?
Die sind sehr niedrig, 2 bis 4 pro Woche.
Ich habe den Eindruck, dass Lehrende und Studierende sehr genau wissen, wie wichtig das Einhalten der Regeln ist, da dadurch künstlerische Praxis weiter ermöglicht werden kann. Für mich ist das eine Frage der Solidarität, da viele nicht die Möglichkeit haben, ihre künstlerische Arbeit ausschließlich von zu Hause aus zu erledigen.
Am 07.10.20, kurz vor einer Kampfabstimmung über die Bundestagskandidatur zwischen Herrn Müller und Frau Chebli haben Sie einen offenen Brief mitunterschrieben.
Warum haben Sie diesen Brief unterschrieben?
Ich denke, dass bei aller berechtigten Kritik Herr Müller enorm viel für die Berliner Wissenschaft geleistet hat, Stichwort Etaterhöhung. Zudem empfinde ich ihn als engagiert und seriös. Trotz Kritik und Meinungsverschiedenheiten, die wir an und mit der Senatskanzlei oder Staatssekretärkraft haben, fand ich Müllers Kandidatur deshalb unterstützenswert.
In diesem Brief wird ausführlich der Wissenschafts- und Forschungsstandort Berlin gelobt, ausdrücklich nicht erwähnt werden jedoch künstlerisch-kulturelle Besonderheiten Berlins, die UdK wird somit gar nicht repräsentiert.
Da haben Sie Recht, die UdK als gleichberechtigte Universität zu positionieren – daran haben wir grundsätzlich zu arbeiten.
Ein Beispiel: Wir schreiben derzeit mit der TU einen Antrag für das Einstein Center zum Thema climate change. An der TU erhoffte man sich von der Zusammenarbeit, über künstlerisch-gestalterische Zugänge eine qualifizierte Form der Wissenschaftskommunikation zu initiieren. Nach dem Motto: wir haben die Wissenschaft und ihr bringt sie schön rüber. Am vergangenen Freitag habe ich deshalb gegenüber Herrn Müller nochmals deutlich gemacht, dass wir eine Institution sind, die sich in einer eigenen kritischen Form innovativ an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligt.
Hängt diese falsche Wahrnehmung vielleicht auch damit zusammen, dass die UdK nicht Teil der Berlin University Alliance ist?
Sicherlich. Jedoch erschwert die in den Statuten der BUA vorgesehene Limitierung auf drei Berliner Universitäten in Anbetracht ihrer wissenschaftlichen Ausrichtung eine Positionierung der UdK anstelle der TU, HU oder FU. In der BUA gibt es starke Verbünde, die auf Klassifizierungssystemen aufbauen. Da wir nicht auf Rankings setzen und nicht so drittmittelstark sind, gewinnen wir am stärksten, wenn wir die künstlerische Eigenform mit einem Erkenntnisgewinn, der auch Relevanz für die anderen Universitäten hat, verbinden.
Deshalb haben wir uns auch klar gegen das in der BerlHG-Novelle [Anm. d. Red.: Reformierung des Berliner Hochschulgesetzes] vorgesehene Verbot des künstlerischen PhD ausgesprochen. Wir arbeiten daran, eine neue Struktur von Wissenschaftlichkeit an der UdK zu etablieren, die in einen Qualifizierungszyklus aus künstlerischer, künstlerisch-wissenschaftlicher oder wissenschaftlicher Arbeit eingebettet werden soll.
In einem Interview sprachen Sie davon, dass die UdK eine Hochschule des 21. Jahrhunderts sein müsse. Ist die UdK Vorreiter, Abbild des Zeitgeistes oder doch eher ein Riesendampfer, der einige Anpassungszeit benötigt?
Letzteres auf alle Fälle, da wir eine sehr starke Binnenkultur haben. Unsere Fakultäten sind größer als die einzelnen Kunsthochschulen, da braucht man Ausdauer.
Die UdK hat in ihrer einzigartigen Breite – wie sie keine andere Hochschule in Europa hat – die unglaubliche Möglichkeit, über die unterschiedlichen Fachkulturen Themen in das System einzuspeisen und dort zu reflektieren. Damit ist sie nicht nur Spiegel der Zeit, sondern Vorreiter, gerade in einer künstlerischen Gestaltung und Betrachtung gesellschaftlicher Fragestellungen.
Wir haben als Institution, die sich während des Nationalsozialismus sehr negativ transformiert hat, sich jedoch wieder re-transformieren konnte, eine besondere Glaubwürdigkeit. Das hilft uns, UdK-spezifische Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden, die in unserer Gegenwart und in die Zukunft gedacht sind, aber einen starken Bezug zu unseren eigenen Institutionsgeschichte aufweisen.
Eine solche Verknüpfung von künstlerischer Praxis und aktuellem gesellschaftspolitischem Diskurs gab es im vergangenen Sommer. Viele Studierende haben sich unter dem Motto #exitrascism mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung an der UdK beschäftigt. Es gab einen offenen Brief und einen Forderungskatalog. Welche Maßnahmen hat die UdK, neben den oben von Ihnen beschriebenen, bereits ergriffen?
Wir sind dabei, zwei Stellen einzurichten: eine*n Antidiskriminierungsbeauftragte*n mit dem Fokus auf Antirassismus und eine psychologische Studienberatung.
Sehr schnell haben wir im Gespräch mit der Kommission für Chancengleichheit und der Studierendenvertretung die Initiative zur Verbesserung der Situation von Transmenschen aufgenommen. In der Folge wurde eine Testphase für all-gender Toiletten gestartet, wir haben die freie Wahl des Vornamens auf den Weg gebracht und sind dabei, alle Hochschuldokumente in gender-neutrale Sprache zu überführen. Manche Forderungen sind für uns aber aktuell schlichtweg nicht zu erfüllen. Aufgrund unseres Budgets können wir nicht eine Reihe von verschiedenen Beauftragten finanzieren, die sich mit unterschiedlichen intersektionalen Diskriminierungstatbeständen auseinandersetzen. Aber wir versuchen, diverse Projekte über Mittel aus dem Berliner Chancengleichheitsprojekt zu unterstützen. Zudem sieht die Novelle des Berliner Hochschulgesetzes etliche strukturell sinnvolle Maßnahmen vor, um deren Finanzierung wir uns im Verbund mit den anderen Hochschulen derzeit beim Senat bemühen.
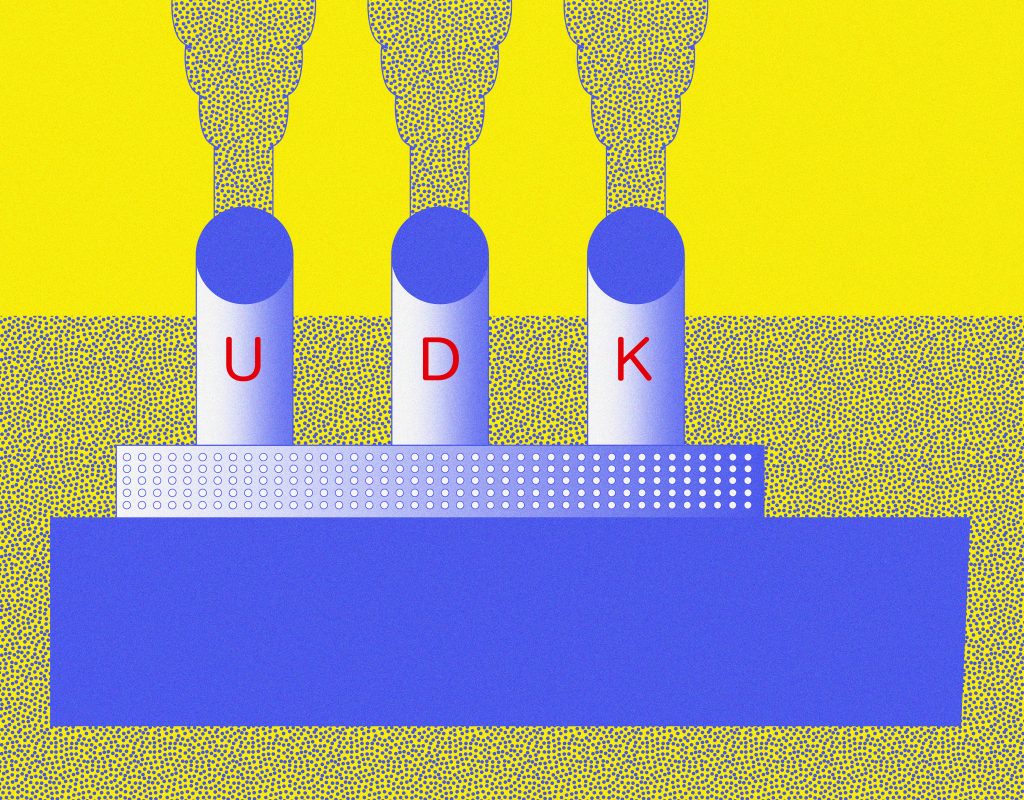
@timstrrrrrrr
Wie steht die Hochschulleitung zur Forderung nach verpflichtenden Quoten für BiPoc, LGBTQ+ und disabled persons in Berufungs- und Zulassungskommissionen?
Verpflichtende Quoten finde ich schwierig, weil es in verschiedenen Studiengängen und Fachkulturen Schwierigkeiten gäbe, eine solche Quote zu erfüllen. Zumal die Menschen, die infrage kämen, dann nur noch in Berufungskommissionen sitzen könnten.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wir uns sehr intensiv bemühen, Personen mit diversem Hintergrund an die Uni zu bekommen, da sie wertvolle andere Blickwinkel zu vielen Themen mitbringen. Aber ganz klar: wir sollten darauf hinarbeiten, dass sich ihr Anteil erhöht.
Es wird von den Studierenden an einer Klimacharta gearbeitet und dort gibt es den Vorschlag, bei der Neubesetzung von Stellen auf die Sensibilität der Kandidat*innen in Bezug auf die Klimakrise zu achten und das auch in die Auswahl miteinzubeziehen. Wie stehen Sie zu solchen ideologisch gefärbten Kriterien?
Solche Prüfungen mag ich nicht. Nicht dass ich es inhaltlich bedenklich fände, nur sollten wir nicht Menschen entlang eines inhaltlichen Kataloges einsortieren, der dann notwendigerweise auch weitere relevante Themen umfassen müsste. Das birgt immer die Gefahr, dass sich neue Machtpositionen materialisieren.
Es handelt sich um die Frage eines Kulturwandels, hin zu einem Bewusstsein einer individuellen Transformationsnotwendigkeit. Ich glaube, dass ein wirklicher Wandel, gerade in Fragen der Nachhaltigkeit, nur über das Bewusstsein des Einzelnen erfolgen kann. Jeder hat sein eigenes Verhalten zu überprüfen und daraus Konsequenzen zu ziehen.
Wie sieht es mit konkreten Handlungsmöglichkeiten an der UdK aus – mit effizientem Heizungsmanagement, Installation von Solaranlagen oder einer Nachbesserung der Gebäudeisolation?
In Teilen stehen dem Schwierigkeiten beim Denkmalschutz im Weg. Wir haben jedoch bereits Solaranlagen auf den Dächern Einsteinufer und Hardenbergstraße. Die Gemeinsame Kommission für Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit, die jetzt vom Akademischen Senat eingerichtet wurde, hat den Auftrag, sich mit möglichen architektonischen Verbesserungen und einem klimasensiblen Gebäudemanagement zu befassen. Zudem soll sie einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen und Vorschläge und Konzepte für Maßnahmen einer nachhaltigen und klimagerechten Entwicklung der UdK erarbeiten.
Es ist jedoch notwendig, dass besonders in der Praxis in neue Richtungen gedacht wird – es gibt aber mittlerweile auch viele Initiativen, sowohl von Lehrenden als auch von Studierenden, die sich dem Problem widmen. Wir haben gerade einen Antrag für die Finanzierung einer/eines Klimaschutzbeauftragten gestellt, die/der diesen Prozess und die Maßnahmen auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Hochschule fakultätsübergreifend koordinieren soll.
In vielen Gebäuden der UdK ist die Barrierefreiheit noch stark eingeschränkt, gibt es einen Zeitplan für den barrierefreien Ausbau von Eingangsbereichen, Treppenhäusern etc.?
Die Gebäude wurden alle begangen und in manchen Gebäuden ist es, nach dem was mir berichtet wurde, einfach nicht möglich, Barrierefreiheit herzustellen – auch aus Denkmalschutzgründen. Wir werden leider mit der Situation leben müssen, dass wir nicht alle Gebäude barrierefrei ausbauen können.
Aber beispielsweise das UniT ist nur über Stufen zugänglich, auch die darüber liegenden Unterrichts- und Seminarräume sind nicht barrierefrei zu erreichen. Das wirkt sich direkt darauf aus, ob Teilhabe oder ein inklusives Studium überhaupt möglich sind.
Ich habe mich mit diesem Problem noch nicht so viel beschäftigt und weiß nur, dass wir in bestimmten Häusern Schwierigkeiten haben. Wie das jetzt mit dem UniT konkret
aussieht, und ob da bereits etwas in Planung ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Natürlich versuchen wir aber, wo immer möglich, diese Barrieren abzubauen.
Wie stellen Sie sich Ihre Zusammenarbeit mit den Studierenden in den kommenden Jahren vor?
Ich bin sehr glücklich, dass uns bereits eine gute und vielfältige Zusammenarbeit gelingt, beispielsweise in regelmäßigen Gesprächen mit dem AStA oder im Erweiterten Präsidium. Sicherlich gibt es grundsätzliche Vorbehalte gegenüber Leitungsfiguren und universitären Hierarchien, aber ich versuche, die Universität im Sinne einer transparenten und beteiligungsstarken Leitungskultur zu führen. Das Präsidium [Anm.: Präsident*in, Erste*r Vizepräsident*in, weitere*r Vizepräsident*in] ist keine Gruppe von Menschen in einem Elfenbeinturm, sondern wir sehen uns als Gesprächspartner*innen. Deshalb ist es mir wichtig, dass Entscheidungsfindungen demokratisch und in einem guten Miteinander ablaufen. Der Weg zu einem Ergebnis ist für mich immer auch eine Frage der Prozessästhetik und Ethik.
Zudem setze ich mich für eine Studentische Vizepräsidentschaft ein, die wir hoffentlich nach Verabschiedung der BerlHG-Novelle einführen können.
Zum Schluss, wenn wir auf die vielen unterschiedlichen Themen schauen, die wir heute besprochen haben, wo hoffen Sie, dass wir am Ende Ihrer ersten Amtszeit stehen?
Ich sehe die UdK in ihrer Relevanz als die führende künstlerische Ausbildungsstätte Europas – nicht wegen ihrer Größe, sondern aufgrund der Aktualität und Qualität in der angebotenen Ausbildung und Forschung.
Ich sehe sie auch als eine Institution, die eine dezidierte Haltung zu einer sich wandelnden technologischen Welt hat, und diese in einer innovativen und radikalen Art künstlerisch gangbar macht – als politisches und künstlerisches Instrument.
Ich möchte, dass wir gemeinsam mit den relevanten Fachvertreter*innen gut konzipierte Qualifikationsformate und eine strukturell verankerte Promotion entwickeln. Zudem sollten wir uns bemühen, eine Institution zu werden, die die gesellschaftlichen Themen im Verbund mit anderen, aber im besonderen Bewusstsein der eigenen Geschichte und unserer Werte durch die Linse der Künste betrachtet.
Schließlich sollten wir Lösungen für die Lehramtsfragen und die damit verbundenen Kapazitäts- und Raumprobleme finden und uns weniger als vier einzelne Fakultäten betrachten. Stattdessen soll eine inhaltlich-künstlerische Ökologie ausgebildet werden, in der räumlich und inhaltlich studiert, kommuniziert und geforscht wird.
Nach den verbleibenden vier Jahren dieser Amtszeit werde ich mich an den Ergebnissen messen lassen.
Prof. Norbert Palz ist seit dem 1. April 2020 Präsident der UdK. Zuvor war er Prodekan der Fakultät Gestaltung und Erster Vizepräsident. Nach einem Architekturstudium an der TU Berlin und zahlreichen internationalen Projekten wurde er zum Wintersemester 2010 als Professor für „Digitales und Experimentelles Entwerfen“ an die UdK berufen.




